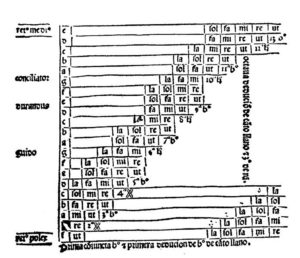Aufführungspraxis polyphoner Musik (Teil 2)
Von Peter Phillips, Leiter der Tallis Scholars
Die Struktur der Polyphonie
Ein Aspekt der Polyphonie, der uns das Leben recht schwer machen kann, ist die fast völlige Abwesenheit von Material, das wiederholt wird, woraus sich für den Dirigenten eine rechte Herausforderung ergibt: welche Form soll und kann er dem Stück geben?
Motetten und Sätze aus Messen, die nach etwa 1520 geschrieben wurden, bestehen normalerweise aus einer Reihung von Imitationsphrasen, wobei jeder neue Satz des Textes einen neuem Themenkopf braucht: Palestrinas Sicut cervus ist ein gutes Beispiel. In Anbetracht der Tatsache, dass die meiste Musik, die näher an unsere Zeit komponiert wurde, vor allem, wenn es sich um eine Sonatenform handelt, sich sowohl für ihre intellektuelle als auch für ihre emotionale Durchschlagskraft auf Wiederholung und Wiederaufgreifen verlässt, ist das Problem, wie man mit einer solch harmlosen Aneinander-Reihung Wirkung erzielt, nicht zu übersehen. Wo gibt es Kontraste? Wenn es keine Rekapitulation gibt, gibt es keinen Sinn, auf eine solche hinzuzielen, und durch sie auch auf ein eindrucksvolles Ende. In der Polyphonie können wir uns auf ein sehr einheitliches Kompositionsidiom verlassen, aber nicht auf ein Gefühl, dass wir am Anfang, in der Mitte oder am Ende eines Stückes sind, denn es findet sich nicht der geringste Versuch, die Harmonie als struktur-verleihenden Faktor einzusetzen; sie dient auch in keiner sonstigen Art und Weise als emotionale Untermauerung des Ganzen. Häufig könnte der harmonische Hintergrund in der Polyphonie kaum einfacher sein, als er ist – und deshalb ist es eine solche Kulturschande, sie in Gebäuden zu singen, wo das Echo so stark ist, dass alles, was man von der Stimmführung hören kann, eine Reihe sich ständig wiederholender Grundakkorde ist. Auch hier kann es vorkommen, dass der Dirigent unserer Tage seine ursprünglichen Vorstellungen in Zweifel ziehen muss.
Die Lösung finden wir, wenn wir eine gute Vorstellung der Struktur des Stückes als Ganzes gewinnen und uns wirklich mit jedem Stück und seinen speziellen Charakteristika auseinandersetzen. Wenn die Musik schlicht ist, gewinnen wir nichts, wenn wir tun, als ob das nicht nicht der Fall wäre. Es sollte kein Zweifel daran bestehen, dass es möglich ist, von jedem polyphonen Stück, ganz gleich wie schlicht, eine eindrucksvolle Aufführung zu erzielen, wenn der Grundklang der [singenden] Gruppe das Publikum anspricht. Man sollte aber mehrmals nachdenken, bevor man schlichte Musik ins Programm eines großen Anlasses aufnimmt: der Dorian Service von Tallis [1505-1585 – Übersetzerin] eignet sich nicht für ein Konzert in einem Saal, der sonst für großes Orchester benutzt wird. Aber selbst die anspruchsvollsten Stücke folgen dem Grundplan: eine Reihung von Imitationen, verbunden nur durch das musikalisch strikt einheitliche Idiom; sie mögen auf- und abschwellen mit hinreißendem Einfallsreichtum und polyphonen Effekten, aber wenn sie nicht einen cantus firmus als Gerüst haben, finden und empfinden wir kaum je, dass wir eine Wandlung von einem emotionalen Standpunkt zu einem anderen erlebt hätten. Der Musik der Renaissance geht es mehr um die Betrachtung eines Gemütszustandes, der vom Text vorgegeben wird, als darum, eine Reihe Gemütszustände zu durchleben. Dennoch wird vom modernen Dirigenten erwartet, dass er mehr mit seinem Material anfängt als nur einen gleichbleibenden Klang zu schaffen, vor allem, wenn das betreffende Stück, wie manche der pompöseren englischen Antiphone, als Einzelsatz fast zwanzig Minuten dauert. Hier kommen wir ohne ein Gefühl für die “Architektur” nicht aus. Ein Stück wie Tallis’ Gaude Gloriosa wäre eine echte Herausforderung für selbst den erfahrensten Dirigenten von Orchestersinfonien (wenn sie sich je begegnen sollten), denn die wenigen Kadenzen tragen alle etwas zum Gesamtbild bei: sie alle sind sorgfältig platziert, nicht nur, um einen Abschnitt des Stückes würdig zu beenden, sondern als Vorbereitung für das “Amen”, den Höhepunkt des ganzen riesigen “Gebäudes”. Meiner Ansicht nach muss der Dirigent, wenn er sich ihnen nähert, genau im Gefühl haben, wo diese Kadenzen in Bezug auf das Ganze stehen – sonst kann man nicht das Beste aus den explosiven letzten paar Seiten herausholen. Genau genommen ist Gaude Gloriosa, obwohl es eins der längsten dieser einsätzigen Stücke ist, nicht eins von denen mit vielen Unterteilungen. Die Tatsache, dass Tallis imstande war, etwas zu schreiben, das dermaßen unwiderstehlich und überzeugend in einem solchen großen Rahmen verläuft, hilft uns dabei zu würdigen, wie hochentwickelt dieser Stil zur Regierungszeit der Königin Mary geworden war. Es gibt viele kürzere Stücke, deren Unterteilungen scheint’s keinen anderen Grund haben, als dass der Komponist sich mit dem nächsten Satz des Textes befassen musste. O Bone Jesu von Parsons [1535-1572 – Übersetzerin] ist ein gutes Beispiel. Der Übergang zum letzten Teil – “Fac meum” stellt eine klassische Herausforderung an den Dirigenten dar. Es scheint, als ob alles in der Musik schon gesagt worden ist; die unüberhörbare Einrahmung der Teile mit homophonen Phrasen, die mit dem Aufruf “O” beginnen, hat schon mehrere Male stattgefunden, wobei die Takte vor “Fac mecum” sich als besonders kraftvoll erwiesen haben. Wie vergrößert man die Spannung durch dieses unerwünschte Satzende hindurch, vor allem, da es auch später keine Hilfe durch etwaige Wiederaufnahme älteren Materials geben wird? Die Antwort ist: mach niemandem etwas vor, finde dich damit ab, wie es ist, und gehe es an mit dem präzisen Bewusstsein für das, was sich bis jetzt in der Musik ereignet hat, und für das, was noch kommen wird. Nach der großen Kadenz, die davor kommt, kann man nichts anderes tun als zurückstecken. Jeglicher Versuch, die Intensität aufrecht zu erhalten, würde falsch klingen, aber dennoch werden wir in ein oder zwei Seiten das “Amen” singen. Meiner Ansicht nach hängt die Durchschlagskraft dieses “Amens” davon ab, wie gut die Ausführenden es vom allerersten Anfang an vorbereitet haben; es reicht nicht, wenn sie plötzlich daran denken, wenn sie bei “Fac mecum” angekommen sind.
In O Bone Jesu stellt Parsons das architektonische Bewusstsein mehr als gewöhnlich auf die Probe – alle Dirigenten, die in ihrer Ausbildung mit den symmetrischeren Konstruktionen der Musik späterer Epochen vertraut gemacht wurden, werden jede polyphone Komposition in dieser Hinsicht als Herausforderung empfinden. Parsons schrieb noch im Stil der Mitte des Jahrhunderts, und es ist eine Tatsache, dass die Musik der Hochrenaissance späterer und vertrauterer Praxis manchmal näher steht. Eine Motette wie Civitas sancti tui von Byrd [1543-1623 – Übersetzerin] ist architektonisch nicht in der Art und Weise konstruiert, die ich eben beschrieb, weil sie dermaßen genau ihrem Text folgt, dass uns allein die Logik der Worte durch alle Fährnisse trägt. Man müsste ein Herz von Stein haben, wenn man nichts aus dem letzten Abschnitt machte – “Jerusalem desolata est”: man muss nicht dafür in derselben Weise planen wie für die “Amens” im abstrakteren Stil, in dem es vorkommen kann, dass man ein Melisma so lange gesungen hat, dass man vergisst, mit welchem Vokal man eigentlich angefangen hat, und ein oder zwei Seiten zurückblättern muss, um den Anfang des Wortes zu finden. Byrd, wie auch Lassus, war auf dem Weg zur barocken Methode der Textvertonung, wenn auch auf Umwegen.
Die Aneignung dieses Sinns für die architektonische Struktur braucht Zeit, mehr Zeit für Tallis und Parsons als für Byrd (und mehr Zeit für die Komponisten einer früheren Generation, wie Josquin und Isaac, als für Männer der Hochrenaissance wie Lassus und de Rore). Daraus ergeben sich eine Reihe Fragen für den Probenablauf. Es besteht kein Zweifel daran, dass der Dirigent sich bemühen sollte, schon zur ersten Probe einer großen Portion abstrakter Polyphonie mit einer genauen Vorstellung zu erscheinen, welche Form er ihr verleihen möchte. Die Schwierigkeit besteht darin, dass, ganz gleich, wie lange er still über der Partitur hockt – oder sie auf dem Klavier durchspielt – er immer noch nicht genau das erfährt, das er eigentlich wissen muss. Es ist nicht nur schwer, sechs oder mehr polyphone Stimmen gleichzeitig im Kopf zu hören, sondern die Musik – ganz abgesehen von der Stimmung, die durch den Text vorgegeben wird – besitzt eben ihre ganz eigene Logik. Der Versuch, diese Logik in gesprochene Worte zu fassen, und dann in dynamische Anweisungen umzusetzen, die ins Exemplar geschrieben werden können, bringt selten etwas ein, das überzeugt, und er verschlingt eine Menge Zeit. Es besteht keine Frage, dass es besser ist, die Musik erst einmal mehrere Male einfach als Musik zu erleben, bevor man auch nur beginnen kann, den Anspruch zu erheben, dass man sie kennt. Es ist eigentlich eine der ganz großen Stärken der Polyphonie, dass viele solche Stücke so vertrackt sind, dass sie fast grenzenlose Wiederholung aushalten, wobei die Ausführenden aber immer noch neue Perspektiven entdecken. Im Idealfall würde man also die Musik in der Probe mehrmals durchsingen, bevor man sie dem Publikum anbietet – aber im Bereich der Laien wie der Profis zahlt sich das nur sehr selten aus. Ein gute Aufführung von polyphoner Musik hängt von der makellosen Beherrschung einer endlosen Folge von winzigen Einzelheiten ab, die man den Leuten nicht in der Probe einbläuen und dann, übertrieben, in der Aufführung liefern sollte – selbst, wenn die Leute sich an alles erinnern können. Man muss diese Einzelheiten instinktiv beim Singen fühlen, und das ist viel mehr ein Prüfstein für die musikalische Erfahrung als für die Stimmtechnik. Wenn man die Polyphonie so probt, nämlich schnell, dann geschieht im Grunde nicht mehr als sicher zu stellen, dass die Töne stimmen (in den gedruckten Noten genauso wie im Gesang), und es kann darauf hinauslaufen, dass man ein Stück nur einmal durchsingt, bevor es zum ersten Mal dem Publikum dargeboten wird.
Wenn wir die Struktur des ganzen Stückes bedenken, so finden wir, dass Sätze aus Messen, und vor allem aus Messen, die auf einem cantus firmus aufgebaut sind, ein Sonderfall sind. In vielen polyphonen Vertonungen des Textes der Messe erscheint eine ganze Menge Material mehrere Male, wenn auch nicht genau im Sinn der Rekapitulation, wie wir sie in der Klassik finden. Komponisten, die ein Gloria oder ein Credo schreiben wollten, hatten ein Problem: sehr viel Text. Wer nicht für jeden neuen Nebensatz einen neuen Themenkopf erfinden wollte, konnte solche wiederverwenden, die schon vorher erklungen waren; wenn man eine solche Messe dirigiert, die auf einem cantus firmus basiert, besteht ein besonderer Reiz beispielsweise darin zu sehen, wie ein einfallsreicher Komponist solch altes Material mit neuem Text neu vorstellt. Durch diese Wiederverarbeitung von Material werden die fünf Sätze einer Vertonung miteinander verbunden, was den Dirigenten dazu zwingt, sich – im Interesse der Abwechslung – sehr sorgfältig Gedanken über die Tempo-Relationen zu machen. Natürlich wurde ursprünglich die Abfolge der Sätze im Gottesdienst durch das gesprochene Wort unterbrochen, wodurch sich die Notwendigkeit, sich hauchfeine Tempovariationen einfallen lassen zu müssen, verringerte; aber es besteht auch echtes Interesse am Durchsingen einer Messe, ein Satz sofort nach dem anderen, wie es im modernen Konzert üblich ist. Ich würde die These vertreten, dass – wenn sie wirklich meisterhaft aufgeführt werden – cantus firmus Messen sogar von dieser Art Aufführung profitieren – eine “Sinfonie” in fünf Sätzen. Aber vielleicht wäre eine genauere Beschreibung eher der Vergleich mit einer riesigen Folge Variationen über ein Thema, als mit einer Sinfonie, auch wenn jeder Satz seinen eigenen Charakter besitzt. Das Agnus garantiert zum Beispiel, dass die Folge normalerweise mit einem langsamen Satz endet.
In diesem Zusammenhang ist es natürlich eine große Hilfe, wenn der Dirigent einen guten Sinn für die Gesamtarchitektur besitzt, die sich in diesem Fall über fünf Sätze erstreckt. So wird er beispielsweise nicht automatisch den ersten Teil des Credos im selben Tempo beginnen, mit dem das Gloria gerade zu Ende gegangen ist, das seinerseits unter Umständen das Ergebnis des Tempos zu Anfang des Glorias sein kann. Wenn das Credo als Art Spiegelung des Gloria dargeboten wird, kann das in anspruchsvolleren Vertonungen darauf hinauslaufen, dass bei der Aufführung viele Minuten und eine nennenswerte Anzahl Teilstücke verstreichen können, alle im selben Tempo (im Fall von Morales’ Missa Si Bona Suscepimus kämen wir auf 25 Minuten), was auf verpasste Gelegenheiten [zur Abwechslung – Übersetzerin] hinauslaufen mag. Damit meine ich nichts Radikales: sehr kleine Unterschiede können dasselbe Gefühl einer neuen Stimmung hervorbringen wie größere. Geringfügige Tempoänderungen verleihen bekanntem Material neue Perspektiven, etwas, dass sich gut mit dem Prinzip verträgt, das der Parodie-Messe zugrunde liegt. Die Frage, ob man das Tempo in der Mitte eines Satzes verändern soll (beispielsweise schneller für “pleni sunt caeli” oder langsamer für “Et incarnatus est”) ist, musikalisch betrachtet, ebenso Teil der Errichtung einer Perspektive. Anders gesagt: die Wirkung des “ausgeliehenen” Materials kann in vieler Weise intensiviert werden – dadurch, dass es in verschiedenen Tempi dargeboten wird, oder dadurch, dass es von neuen Gegenthemen begleitet erscheint (beides zusammen ist noch besser). So ist der Dirigent in der Lage, eine wichtige Rolle im kreativen Prozess zu spielen, vor allem, wenn der Komponist in seiner Verwendung des ausgeliehenen Materials nicht besonders einfallsreich war (man denke an Lassus).
Klangfarben und Anzahl der Sänger in derselben Stimme
Meine ideale Klangfarbe habe ich schon erwähnt, aber nicht die Art Singstimme, von der sie hervorgebracht wird. So wie ich mir die Polyphonie vorstelle, braucht sie helle, starke und bewegliche Stimmen ohne Vibrato, aber nicht farblose Stimmen, und sie müssen von Natur ein gutes Legato über einen weiten Tonumfang besitzen. Andere Chorleiter, die sich auf die Musik der Renaissance spezialisieren, vor allem solche, die nicht aus England kommen wie Paul van Nevel, scheinen zu denken, dass sie recht kleine Stimmen benötigt, dem Klang der Blockflöte ähnlicher als dem der Naturtrompete. Das mag einfach an der Art Sänger liegen, die vor Ort verfügbar sind; in dem Augenblick, wo sie Gesangsunterricht bekommen und lernen, ihre Stimmen tragfähiger zu machen, schaffen sie sich ein Vibrato an, was Paul und seine Kollegen dazu veranlasst, verhältnismäßig unausgebildete Stimmen einzusetzen; oder es mag an der Überzeugung liegen, dass der Klarheit der Stimmführung besser gedient wird, wenn die Stimmen nicht zu reich an Obertönen sind. Ich habe für diese Ansicht ein gewisses Verständnis, und ich bewundere van Nevels so ganz andere Fassungen von Werken, die auch wir gesungen haben (vor allem die großen Stücke wie Brumels zwölfstimmige Messe; Spem in alium von Tallis; Josquins 24-stimmigen Kanon); aber der Gesamteindruck ist weniger mitreißend, hat weniger Leuchtkraft, klingt zu sehr mit Einzelheiten befasst. Mein Klangfarbenideal besitzt einen Kern aus Stahl, und ich glaube, dass meine Versuche, diesen zu schaffen, zur Entwicklung einer neuen Art Stimme für Berufssänger beigetragen hat, einer Stimme, die bis in die letzte Reihe des Opernhauses in Sydney trägt, ohne dass verzerrendes Vibrato eingesetzt würde (wir dürfen nicht vergessen, dass es nie ganz ohne Vibrato abgeht).
Die Einspielungen von van Nevel zeigen, dass er sicher mit mir einer Meinung ist, wenn ich konstatiere, dass die gleichwertige Hörbarkeit aller Stimmen eine Grundvoraussetzung für das Singen von polyphoner Musik ist. Wenn wir nicht danach strebten, bewiese das Respektlosigkeit gegen die wahre Natur dieses Kompositionsstils. Die notwendige Klarheit kann nur durch gute Intonation und gute Mischung der Klangfarben erzielt werden. Schlechte Intonation führt zu Undurchsichtigkeit der Struktur, weil die Linien sich verwischen, und wenn die Mischung der Klangfarben nicht klappt, stechen einzelne Sänger aus der Struktur heraus, und diese Partiturstimmen sind dann unentwegt lauter als andere. Daraus ergibt sich, dass ich mir Sänger wünsche, die mit einer farbigen Stimme singen können, ohne dass das zu Undurchsichtigkeit führt; die zuhören, selbst wenn sie selber laut singen; und mit der Beweglichkeit, die ihnen gestattet, mit Einfühlungsvermögen innerhalb des gesamten großen Tonumfangs singen zu können, den die Komponisten der Renaissance gern benutzten, denn während des größten Teils dieser Periode der Musikgeschichte lassen sich die modernen SATB Stimmumfänge nur sehr ungefähr einsetzen. Ich setze bewusst je zwei Sänger für eine Stimme ein, statt nur einen, weil es mir genau darum geht, einen chorartigen, vermischten Klang zu erzielen, nicht den Klang, der sich ergibt, wenn jede Stimme einzeln besetzt wird, mit all den Unterbrechungen im Legato, die das direkte Resultat sind. Und letzten Endes glaube ich, dass ich tun würde, was all die führenden Chöre der Renaissance taten – die musikalisch intelligentesten Leute anzustellen, die zu haben sind, nicht nur die mit schönen Stimmen.
Es ist mir wichtig gewesen, dass die Sänger, die für alle Stimmen in der Gruppe ausgewählt wurden, denselben Stimmtypus repräsentierten, aber bei den Sopranen war es noch wichtiger. Und wenn sie erst einmal zur Gruppe gehören, dann müssen sie – um das Ideal aufrechtzuerhalten – sich strikteren Richtlinien anpassen als die Sänger der tieferen Stimmen, nicht nur, dass sie zu zweit auf einer Stimme sind, selbst wenn in achtstimmiger Musik die anderen Zeilen einzeln besetzt sind, sondern weil sie noch präziser als die anderen an der Kunst des chorischen Atmens arbeiten müssen. Es ist vorgekommen, dass das Publikum nicht bemerkt hat, dass ein Alt, ein Tenor oder ein Bass nicht wirklich geeignet waren (auch wenn diese Tatsache sich bei wiederholtem Zuhören rasch bemerkbar machen würde); aber es ist unmöglich, eine ungeeignete Sopranklangfarbe zu kaschieren, vom ersten Ton an. Nebenbei – jeder Hörer, der etwa meint, dass diese Soprane wie Knaben klingen, beweist, dass er sich weder diese Soprane noch Knaben wirklich genau angehört hat. Keine Frage, dass diese Soprane MEHR wie Knaben klingen als das bei traditionell ausgebildeten Opern-Sopranistinnen der Fall ist, aber deren Singweise ist solche Welten von dem entfernt, um das es uns hier geht, dass es in der Praxis irrelevant ist.
Wie viele Stimmen pro Partiturzeile wären nun ideal? Gleich zu Anfang habe ich entschieden, dass zwei am besten sind. Mit zweien erzielt man einen echten Chorklang, bei dem die Teilnehmer in enger Verbindung miteinander stehen, um durch chorische Atmung ein ununterbrochenes Legato zu erzielen. Die Stimmen mischen sich gewöhnlich besser als wenn eine Partiturzeile solistisch besetzt wird, wodurch die Gefahr wächst, dass einzelne Sänger herausstechen. Wenn Stimmen nur einzeln besetzt sind, hat das natürlich den Vorteil, dass die Sänger sich untereinander besonders leicht verständigen können, was die Chancen für Feinheiten der Phrasierung und Rubato verbessert, aber es funktioniert nur wirklich gut in Stücken, die aus kurzen oder leicht unterteilbaren Phrasen bestehen. Meiner Ansicht nach benötigen die längeren Linien und schon das Klanggewicht der Polyphonie der Hochrenaissance die Ausführung durch einen Kammerchor.
Drei oder mehr Stimmen pro Partiturzeile können diesen gewichtigeren Klang liefern, aber die Zunahme der Zahl der Sänger hat auch Nachteile. Wenn wir drei Sänger pro Partiturzeile haben, ergibt sich das Problem, dass zwei von ihnen nicht nebeneinander stehen, und das reduziert die Mühelosigkeit der Dinge, die sie gemeinsam tun müssen, als ob sie eins wären: Atmung, Intonation, Klangfarbenmischung. Mit vieren wird diese Mühelosigkeit noch weiter beeinträchtigt, und so weiter, so wie die Zahl der Sänger sich vergrößert. Meine Erfahrung ist, dass ich es in dem Augenblick, wo die Zahl drei übersteigt, mit einem ganz anderen Klang zu tun habe, und meist auch mit einer anderen Art Sänger – der Klang wird allgemeiner, die Verantwortung eines jeglichen Sängers so weit reduziert, dass ich als Dirigent alle Entscheidungen treffen muss, weil es niemanden im Chor gibt, der hören kann, was alle anderen anstellen. Mit zweien kann jeder mitentscheiden, denn sie hören genug, um in der Lage dazu zu sein, aber es klingt doch wie ein Chor. Wie ich schon oben erläutert habe – es ist besser, wenn alle Anwesenden im Konzert spontan zur Interpretation beitragen: Sänger und Dirigent. Jede Zunahme der Anzahl verringert die Chance, dass dies geschieht.
Ich gebe zu, dass drei oder vier Sänger pro Partiturzeile sich gut vermischen können, unter der Voraussetzung, dass die Sänger die richtige Einstellung haben, und dass das Gebäude nicht au hallig ist.
Hier stoßen wir mit einem weiteren Tabu zusammen, einem Überbleibsel von einer verflossenen Zugangsart zu dieser Musik. Riesige Kirchen mit großzügiger Akustik galten lange als ideale Orte für das Singen: die Vision eines engelsgleichen Chors, von fernher gehört, der Klang durch den Widerhall in einem gotischen Kirchenschiff auch noch mit einem Heiligenschein versehen, hat sich als sehr verführerisch und langlebig erwiesen. Das Problem besteht darin, dass selbst ein kleines Echo die polyphone Musik richtiggehend zerstören kann, in genau der Art und Weise, in der zu viel Vibrato der Singstimmen sie zerstören kann, denn die Polyphonie lebt von einem ununterbrochenen Strom kleiner, kammermusikalischer Einzelheiten, die sich in sehr halligen Bedingungen zu einer Folge nicht besonders interessanter Akkorde verwischen. Dieses Verwischen erschwert es wiederum auch den Sängern, sich gegenseitig zu hören und sich so auf eine Interpretation zu einigen, wodurch dem Zuhörer weitere Feinheiten der Aufführung verloren gehen. Gebäude mit sehr trockener Akustik können natürlich auch zur musikalischen Hölle werden, aber manche der trockeneren schaffen zumindest doch die Umstände, unter denen eine einfühlsame und interessante Aufführung stattfinden kann, wo die Sänger volle Kontrolle besitzen über das, was sie tun, und wo das Publikum alles hören kann. Meine Lieblingssäle für geistliche polyphone Musik sind die modernen Säle, konzipiert für sinfonische Konzerte, wo die Ingenieure, die für die Akustik verantwortlich waren, einen klaren, abgerundeten Grundklang geschaffen haben. Heutzutage können solche Säle auch noch häufig modifiziert werden, indem Türen zu besonderen akustischen Räumen hoch unter der Decke geöffnet oder geschlossen werden.
Es ist logisch, dass die polyphone Musik in einem Stil gesungen werden sollte, der sich von der Musik ableitet, die der Renaissance voranging, nicht von der Musik, die auf sie folgte. Aber so logisch wie das ist, in der Praxis ist es fast unmöglich, die Ausbildung in späterem Repertoire, die wir alle durchgemacht haben, rückgängig zu machen; in anderen Worten: wir leben in einer anderen Epoche, und wir haben das Recht, moderne Ohren mit der Musik vergangener Zeiten vertraut zu machen. Im Lauf der Jahre haben die Tallis Scholars sich zu einem Gleichgewicht durchgetastet zwischen dem Singen mit modern ausgebildeten Stimmen und dem Singen in einem Stil, von dem wir annehmen, dass er der Musik gerecht wird. Das ist ein Kompromiss, aber zumindest ist es einer, der aus der Spezialisierung auf dieses Repertoire erwachsen ist, mit dem einen Ziel, wie dies Repertoire am besten zum Erklingen gebracht wird. Im Idealfall hätten die Sänger nie etwas anderes als Gregorianik gesungen, bevor sie der polyphonen Musik begegneten, damit sie nur die Sorte Legato kannten, die diese Musik braucht, damit sie die Art und Weise fühlen, in der die Melodien der Gregorianik fließen, anschwellen und wieder versinken, damit sie sich nie wieder einem Taktstrich verpflichtet fühlen. Aber die unausgebildeten Stimmen von Mönchen – wie auf historischen Aufnahmen der Mönche von Solesmes zu hören – machen nur einen begrenzten Eindruck, und sie würden verloren klingen in einem großen modernen Konzertsaal. Unser Kompromiss war nicht zu vermeiden und, wenn wir uns an die striktesten Richtlinien halten von dem, was diese Musik verlangt, so sind wir teilweise erfolgreich gewesen. Ich habe noch nie einen Chor gehört, der nur Erfahrung in Gregorianik hat, der polyphone Musik so singt, dass ein großer Saal mit seinem Klang gefüllt wird, und ich werde auch nie einen hören.
Aber was ich sehr wohl gehört habe sind zahllose Chöre, die polyphone Musik in gemischten Programmen mit späterer Musik singen, und es fällt mir immer auf, wie ungemütlich das frühe Repertoire manchmal klingt, unter dem Joch der viertaktigen Periodik, mit plötzlichen dynamischen Änderungen, wenig Sinn dafür, wohin diese langen melismatischen Phrasen zielen. (Am nächsten, kommt man vermutlich an dies Ideal mit [britischen = Übersetzerin] Chorknaben, die sich einen guten Teil ihres Gesangslebens auf Gregorianik im Gottesdienst konzentrieren. Natürlich bleiben sie moderne Menschen, beeinflusst vom Hören späterer Musik, aber ich war kürzlich wirklich beeindruckt, als ich die Knaben von Westminster Cathedral [römisch-katholische Kathedrale in London, nicht zu verwechseln mit Westminster Abbey, das zur anglikanischen Kirche gehört und wo viele Feierlichkeiten des Königshauses stattfinden – Übersetzerin] mit romantischer Musik hörte, die von ihren Harmonien lebt. Stilistisch klang es überraschend, weil sie gelernt hatten, den Text legato zu singen, wie es zur Gregorianik passt; die Silben schmolzen in ein glattes Kontinuum zusammen, das sich ganz und gar nicht für die abgeteilten Phrasen eignete, um die es hier ging. Aber sie sind nun schon seit Jahrzehnten berühmt für ihre stilgerechten Aufführungen von polyphoner Musik, einem Stil, der von ihrer täglichen Erfahrung in der Gregorianik unterstützt wird. Es war sowohl eine Freude als auch eine Lehre, im September 2012 einige der Nachtgottesdienste mit den Männerstimmen dieses ausgezeichneten Chores als Teil eines Chorfestivals unter Leitung von Martin Randall zu singen.)
Ich bestelle Sänger nie zum Vorsingen, denn ich bezweifle, dass ich von ihren vorbereiteten Stücken würde erkennen können, wie gut sie polyphone Musik singen können. Vermutlich würde ich etwas darüber lernen, was für eine Art Stimme sie haben und wie gut sie vom Blatt singen, aber ich würde nicht lernen, wie gut sie auf ihre Nachbarn hören, wieweit sie instinktiv bereit sind, sich ihnen anzupassen, und was für ein Gefühl sie für melodische Linien besitzen, die nur im Zusammenhang mit anderen melodischen Linien existieren. Wir haben es gut in London: es stehen viele Kandidaten zur Auswahl, und der Tag wird kommen, an dem ich die endgültige Entscheidung, wer von uns als Sänger angenommen wird, dem Sänger überlasse, neben dem der Neuankömmling wird stehen müssen. Auf diese Weise sollte es schon einmal zumindest ein gewisses Einverständnis geben, bevor es wirklich losgeht. Und genau so wie es vorkommen kann, dass ich Sänger noch nie vor ihrer ersten Probe mit uns gehört habe, bin ich sehr vorsichtig mit meinem Urteil in dieser oder irgendeiner anderen Probe, sondern gehe nur danach, was ich im Konzert höre, und möglichst im Verlauf einer ganzen Reihe Konzerte. Die einzige gerechte Methode, Sänger zu beurteilen, die Geschick zur Polyphonie besitzen, besteht darin, den Durchschnitt einer ganzen Reihe Veranstaltungen zu betrachten, zum einen, weil die Anforderungen des Repertoires sehr unterschiedlich sind, und zum anderen, weil jeder einmal einen schlechten Tag hat. Ich bin manchmal begeistert gewesen vom ersten Auftritt von Leuten, die die perfekteste hohe Palestrina-Stimme unter den entspannten Bedingungen einer Probe hinlegen, nur um mich zu wundern, wovon ich so begeistert war, wenn ich sie unter schlechten akustischen Bedingungen in einem Konzert singen höre; oder wenn das Schicksal ihnen eine Stimme zugeteilt hat, die unentwegt gerade ein kleines bisschen zu tief für sie liegt (und das noch unter schlechten akustischen Bedingungen im Konzert). Die Durchschnittsleistung ist das, worum es geht, ganz abgesehen von der Zeit, die verstreichen muss, bis der Neuankömmling sich an die kleinen Einzelheiten unseres Stils gewöhnt hat – die haargenau rhythmisch korrekte Platzierung der kürzeren Noten – Neuankömmlinge sind durch die Bank in den ersten paar Monaten zu hastig mit ihren Achteln und Sechzehnteln; das Durchhalten der erwünschten Legatophrasierung durch das gesamte Programm; sie dürfen nicht halb erwarten, dass die Musik in leiseren Abschnitten langsamer wird (und auch noch intonationsmäßig absinkt), oder in lauten schneller wird.
Tonhöhen
Eine der Entscheidungen, die der Dirigent polyphoner Musik im Voraus treffen muss, ist die Tonhöhe, auf der sie gesungen werden soll. Im Großen und Ganzen wenden wir eine Transpositionstheorie an, die in den 1970er Jahren durch die Aufführungen von David Wulstan und die Clerkes of Oxenford weit verbreitet wurde, die aber schon seit den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts in Gebrauch war. Das läuft im Grunde darauf hinaus, dass der Großteil des englischen Repertoires eine kleine Terz höher transponiert wird als das, was im Manuskript steht, weil eine Note, die während der Renaissance geschrieben wurde, einen Ton darstellt, der fast eine kleine Terz höher ist als das, was diese geschriebene Note heute für uns bedeutet. Der anfechtbarste Teil dieser Theorie kommt zum Tragen, wenn sie auf englische Musik angewandt wird, weil die oberste Stimme dadurch so hoch liegt, dass sie Spezialisten benötigt, aber es ist eine Tatsache, dass seit vielen Jahren auch viele andere Repertoires gewohnheitsmäßig nach oben transponiert worden sind. Was man auch von den Beweisen hält, die Ergebnisse können sehr eindrucksvoll sein. Ich erwähne das hier, weil die Entscheidung, ob transponiert wird oder nicht, oft ernsthafte Konsequenzen auf das Gleichgewicht und die Klarheit des Ensembles mit sich bringt. Von aller Kritik, die wir einstecken müssen – am allerhäufigsten, und mit größter Berechtigung – als für alles andere, das wir tun, werden wir für unsere hohen Interpretationen englischer Musik kritisiert. Es ist wirklich ziemlich wahrscheinlich, dass – wenn die oberste Stimme (“treble”) sehr hoch liegt, die tieferen Stimmen, vor allem wenn es unter diesen eine oder mehrere tiefe Tudor Kontratenorstimmen gibt, überrollt werden. Es gibt zwei Alternativen: nicht immer konsequent zu sein – denn es ist eine lang-etablierte Praxis, Repertoire ohne treble-Stimmen eine kleine Terz oder mehr aufwärts zu transponieren – und dies besondere Repertoire so zu singen, wie es ursprünglich geschrieben wurde; oder sich den Anforderungen zu stellen.
Ich schlage mich immer noch mit den ziemlich exotischen Problemen der hochtransponierten Lösung herum, zum einen, weil ich – wenn wir so singen, wie notiert – die Leichtigkeit des Klanges vermisse, zum anderen, weil ich finde, dass – wenn wir die Stücke tiefer nehmen – die Störungen des Gleichgewichtes, die von den Stimmumfängen in hoher Lage verursacht werden, sich einfach auf die tieferen Texturen verlagern. Dort braucht man dann ein bisschen länger, bis man es merkt, da die höchste Stimme nicht mehr beteiligt ist, aber früher oder später wünscht sich einer der Tenöre doch, dass er nicht so unentwegt hoch singen müsste, besonders, wo die Basslinie nun auch für manche Bass-Baritone ziemlich tief liegt. Die Altisten (die nun die Stimme singen, die zu Tudorzeiten “mean” hieß), können auch ungemütlich hoch klingen, was dazu führt, dass die Basslinie im Gesamtklang verschwindet, während die Mittelstimmen in Gefahr sind, zu wichtig und klobig zu klingen. Da ich Antiphone lieber luftig als massiv mag, habe ich versucht, eine Oberstimme zu entwickeln, die so leicht wie Altweibersommer ist. Das ist sehr schwierig, und es braucht schon mal viele Jahre, um das zur schönen Kunst zu erheben. In den ersten Jahren der Gruppe bestand die ständige Gefahr, dass die Sänger – und aus Sympathie auch das Publikum – nach den großen Stücken (und die sind lang) einen wunden Hals hatten. Inzwischen, vor allem in Spem, wo es acht solche hohe Stimmen gibt, hat die Erfahrung einen Ausweg vorgeschlagen. Es ist möglich, dass man sie so schweben lässt, dass sie eher ausdrucksvoll als anstrengend klingen, und das hilft schon mal ein gutes Stück dazu, dass das Gleichgewicht mit den unteren Stimmen nicht leidet. Unsere neueste Aufnahme – Taverners Missa Gloria tibi Trinitas – stellt meines Erachtens einen weiteren Schritt dar auf dem Weg zu einem aufs Ganze gesehen zufriedenstellenden Gleichgewicht der Stimmen in einer wahrlich massiven Komposition mit hohen Sopranstimme.
Eine Methode, dem Gleichgewicht aufzuhelfen, besteht darin, dass man einen hohen Tenor neben Falsettisten auf den Kontratenorstimmen einsetzt. In derselben Weise kann man auch einen hohen Bariton beim Tenor mitlaufen lassen, oder sogar bei den Kontratenorstimmen – der Bariton Bertie Rice half bei der gesamten Gloria tibi Trinitas Aufnahme bei den tiefen Tönen beider Kontratenorstimmen aus. Die Notwendigkeit, solche Kombinationen aufzustellen, ist im Grunde nur das Eingeständnis, dass der Stimmumfang der Renaissance sich nicht mit dem deckt, was wir heutzutage erwarten und was im Gesangunterricht gelehrt wird, eine Tatsache, mit der wir nicht nur in der englischen Polyphonie, sondern auch im größten Teil der flämischen Polyphonie konfrontiert werden. Sänger, die sich mit diesem Repertoire befassen, müssen einfach bereit sein, ihr Geschick den Umständen anzupassen, und im Fall der Verdoppelung einer Linie mit einem Sänger aus einer anderen Stimmgruppe bedeutet das die Übernahme oder die Aufgabe der Linie, wie sie sich in den eigenen Stimmumfang hineinbewegt, oder aus ihm heraus. Gleichzeitig müssen alle Sänger, die an dieser Linie beteiligt sind, zur Interpretation als Ganzes beitragen, und dazu gehört eine solche Portion Einfühlungsvermögen, wie man sie kaum bei einem Berufssänger finden wird, der sich der Aufgabe mit der Einstellung nähert: “Dies ist, was ich gelernt habe, dies ist meine Stimmlage: ich bin nicht gewillt, auf irgendeine andere Art und Weise zu singen”. Man kann das verstehen, aber Leute, die so denken, stellt man nicht ein. Und wo wir gerade ohnehin beim Thema der Überschneidung zwischen dem Weiblichen und dem Männlichen sind – in den letzten paar Jahren ist es eine Kraftquelle gewesen, dass wir einen Mann und eine Frau nebeneinander auf der Altstimme hatten. Ursprünglich, als wir immer noch versuchten, uns an die Stimmregister der Kathedralchöre zu halten [historisch singen in englischen Kathedralchören und in den Chören der Colleges von Oxford und Cambridge Knaben nur die oberste, Sopranstimme oder -stimmen. Der Alt wird von falsettierenden Männern übernommen – Übersetzerin] hieß es, dass das doch zu weit in die Richtung eines rein weltlichen Klanges ginge. Aber es funktioniert wirklich gut, die Stimmen mischen sich perfekt, und es gestattet uns die Flexibilität eines Stimmumfangs, der riesig sein kann, wenn der Mann für die tiefsten Töne seine Bruststimme benutzt und die Frau die Noten ausfüllt, die für einen Falsettisten allzu schwierig sind, in der Mittellage. Diesen Erfolg verdanken wir den Sängern, um die es hier geht: Caroline Trevor, Robert Harre-Jones und Patrick Craig. Wir haben noch nie einen weiblichen Tenor eingestellt, aber theoretisch hätten wir nichts dagegen.
Diese Stimmumfänge veranlassen uns zu der Frage, was für Sänger die Komponisten der Renaissance im Sinn hatten, denn es ist schwer vorstellbar, dass sich Kehlen in ein paar hundert Jahren so geändert haben, oder dass die Ernährung eine gar so durchschlagende Wirkung auf den Stimmumfang ausgemacht hat. Ich vermute – bewiesen werden kann es nie – dass auch hier das spätere Denken Hindernisse in den Weg gelegt hat. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich zu den Zeiten, bevor Singstimmen über ein Orchester hinweg gehört werden mussten, niemand um die modernen Techniken der Stimmprojektion kümmerte. Wenn heute Schlagersänger nur für sich selbst singen (oder, wenn’s öffentlich ist, ins Mikrofon), dann bemühen sie sich keinen Deut um Stimmprojektion, sondern sie singen ohne Anstrengung mit Bruststimme, Kopfstimme oder Falsetto, wie es der Tonumfang verlangt. Die Tonumfänge der Renaissance legen es sehr nahe, dass dies auch die Methode der Sänger der Zeit war, was uns dazu bringen sollte, dass unser Vorbild nicht Jessye Norman sondern Sting sein sollte. Keine Singakademie, die auf sich hält, würde Geld dafür nehmen, den Leuten etwas beizubringen, das sie von Natur aus können, was die Tatsache erklärt, dass wir von keinem Gesangsunterricht in der Musikgeschichte wissen, bis die Teilnahme von Instrumenten das erzwang. Ich akzeptiere auch den Einwand, dass ich – wenn ich hiermit recht habe – hier ein weiteres Argument dafür liefere, das zeigt, dass der laute, stahlklare Klang der Tallis Scholars weit davon entfernt sein muss, wie die Chöre der Renaissance klangen.
Abgesehen von den ungewohnten Tonumfängen, die Josquin, Cornysh, Taverner und ihre Zeitgenossen in der Hochrenaissance dem modernen Chor mit schöner Regelmäßigkeit auftischen, gibt es ein Problem bei Palestrina, das seltener zur Debatte steht und ganz für sich schon ein kleines Studiengebiet darstellt. Wo englische Komponisten, wenn sie Stücke für mehr als vier Stimmen schrieben, dazu neigten, zwei Kontratenorstimmen zu haben, da verlangte Palestrina zwei Tenöre. Im modernen Zusammenhang ist das nicht nur rücksichtslos, weil es von allen Stimmgruppen am schwersten ist, Tenöre zu finden, aber Palestrina machte das Problem noch größer, indem er für diese Tenöre ungewöhnlich hohe Stimmen schrieb, mit dem (geschriebenen) hohen A als regelmäßigem Höhepunkt. Und selbst wenn das hohe A für Palestrina und seine Zeitgenossen nicht das war, was wir als hohes A hören – wegen einer Verkettung von Anpassungen, die wegen veränderter Praxis nötig sind, so singen die “Tenöre” immer noch eine Terz höher am obersten Ende ihres Tonumfangs als die “Soprane” an ihrem oberen Ende, etwas, das in englischer Musik nie vorkam, selbst wenn die oberste Stimme sich im “mean” aufhielt und es keine “trebles” gab. Dies ist auch in der flämischen Schule selten. Die Regelmäßigkeit, mit der Palestrina die oberste Stimme nur eine Sexte über dem Tenor verlaufen ließ, wirft einige unbequeme Fragen auf in Bezug auf die Stimmtypen, die er wirklich im Sinn hatte. Da wir wenig über den Klang wissen, den die Sänger der Sixtinischen Kapelle zu seiner Zeit hervorbrachten – außer, dass es weder Knaben noch Kastraten auf der obersten Stimme gab, sie waren alle Erwachsene aller Altersgruppen – ist es für uns schwer, uns vorzustellen, was für einen Klang er hörte. Wir vereinfachen zu sehr, wenn wir denken, dass es reichlich Falsettisten und hohe Tenöre gab: es gibt sie heutzutage nicht; und ich bezweifele sowieso, dass die Falsetto-Stimme, im modernen Sinne, wo sie im vollen Stimmumfang eingesetzt wird, schon so früh als regelmäßig eingesetztes “Instrument” existierte. Aber Palestrinas Tonumfänge sind einmalig, was nahelegt, dass er für ein Ensemble schrieb, dessen Zusammensetzung und deshalb auch Klang nicht nur anders war als unsere heute, sondern auch anders als sonst irgendwo zu seiner Zeit.
Moderne Herausgeber, die Exemplare für den Standard SATB-Chor verkaufen wollten, haben dazu geneigt, Palestrinas fünfstimmige Stücke zu übergehen und sich lieber mit seinen vier- und sechsstimmigen zu befassen, was schon einmal schlagartig dazu führt, dass die Kenntnis seiner Werke wesentlich eingeschränkt ist. Was wir heutzutage brauchen, sind in erster Linie Stücke mit zwei Sopranstimmen, und nur in zweiter Linie mit Teilungen der anderen Stimmen. Fünfstimmiger Palestrina mit zwei Sopranen ist sehr selten, während seine sechsstimmigen Stücke oft zwei Soprane sowie zwei Alt- oder zwei Tenorlinien besitzen. Darum gibt es viele Aufnahmen von Palestrinas Missa Assumpta est Maria (SSATTB) und keine einzige außer unserer von seiner Missa Nigra Sum oder Missa Sicut Lilium (beide SATTB), obwohl sie hervorragende Stücke sind. Es gibt viele weitere Messen und Motetten in dieser unbequemen Kategorie. Was kann man machen? Alles deutet hin auf die unbeliebte Lösung, einen sehr großen Teil von Palestrinas Musik um etwa eine Quarte abwärts zu transponieren, wobei dann die oberste Stimme für Falsettisten (oder möglicherweise nur für hohe Tenöre) wäre, und die anderen Stimmen auf eine Mischung von tiefen Tenören, Baritonen, Bässen und tiefen Bässen zu verteilen. (Das Problem der modernen Chöre, vor allem in Universitäten, die nur junge Stimmen und deshalb nur sehr wenige profundi haben, betraf natürlich das Personal der Sixtinischen Kapelle nicht, deren Durchschnittsalter sogar recht hoch war.) Wenn man dies in großem Maßstab durchführen sollte, dann müsste sich die vorherrschende Meinung, dass Palestrinas Klangwelt hell und leuchtend war, von Grund auf neu orientieren. Aber, obwohl die Personallisten der Sixtinischen Kapelle im 16. Jahrhundert diese Lösung nahelegen, gibt es andere Möglichkeiten. Wenn wir das Stück einen Ton abwärts transponieren, so entpuppen sich seine normalen Tonumfänge oft als eine bescheidene Sopranstimme, einen gewöhnlichen Alt, einen etwas hohen Tenor und einen etwas hohen Bass (oder mehrere davon). Das ist die Normalfassung von Palestrina gewesen, seit er im 19. Jahrhundert wieder ausgegraben wurde, und auf dem Papier erscheint das akzeptabel. Der einzige Haken ist der, dass die Lage des Tenors und des Basses hoch bleiben; besonders für die Tenöre ist eine ganze Messe in dieser Tonlage ausgesprochen anstrengend, obwohl sie nie über G müssen.
Musica ficta[1]
Musica ficta ist ein Aspekt der Aufführungspraxis, der mich kalt lässt, obwohl ich das Gefühl habe, dass ich mich damit befassen sollte: ein Stück kann schließlich durch seine music ficta total verändert werden. Das englische Repertoire wäre viel weniger wert, wenn seine berühmten Dissonanzen, von denen die meisten durch music ficta veranlasst sind, nicht mehr gestattet wären. Die Musik von Gombert wäre schon seit Jahren berühmt, wenn man ihm dieselben musica-ficta-Rechte zugestanden hätte, deren sich die Engländer schon immer erfreuten. Aber obwohl sich in meiner Grundeinstellung zur Aufführung von polyphoner Musik in diesen 40 Jahren gewisse grundlegende Anforderungen nicht verändert haben – wie das Ignorieren dieses ganzen Blödsinns über die zeitgenössischen regionalen Aussprachen von Latein, Englisch, Französisch und was es sonst noch so gibt; das Auffinden von genau den richtigen Stimmen, die meiner Klangvorstellung entsprechen – wenn es um musica ficta geht, bin ich unsicher, bewege mich in Schlangenlinien und ändere meine Einstellung alle paar Jahre.
Ich lebe in der feigen Hoffnung, dass der Herausgeber immer zuverlässig die richtigen Entscheidungen getroffen hat, dass diese Entscheidungen gut waren, und dass wir uns nicht in der Probe darüber streiten werden. Es ist mir lieber, wenn mich niemand nach meinen Vorlieben fragt, aber wenn es sein muss, dann war meine Antwort bis vor etwa zehn Jahren, Im Interesse der Einheitlichkeit all diese hinzugesetzten Vorzeichen herauszuwerfen (unsere Aufnahme von Brumels “Erdbeben”-Messe Zeugnis legt davon Zeugnis ab, die ein Denkmal des sentimentalen Zugangs darstellt). Seitdem habe ich mich langsam aber sicher dazu durchgerungen, in Kadenzen Leittöne anzuheben, dann nicht nur in Kadenzen, mit allen möglichen Zwischenstadien. Ich habe mich schließlich von dem möchte-gern mittelalterlichen Klang entwöhnt, den die Herausgeber dieser beängstigenden Gesamtwerk-/Opera Omnia Ausgaben, die seit den 1930er Jahren veröffentlicht wurden, in mir verankert hatten, und die auf den Regalen aller guten Bibliotheken zu finden sind; aber ich bin noch nicht zahlendes Mitglied der Fraktion, die sich eisern nur nach der Melodieführung richtet, wonach der Leitton routinemäßig angehoben werden muss, wenn er zum Schlusston führt, ganz gleich, was der harmonische Zusammenhang ist. Genausowenig schlucke ich bedingungslos das Vermeiden eines Tritonus als Grund, musica ficta zu bemühen. Lass die Leute verminderte Quinten singen, wenn der Eindruck der Musik davon profitiert. Und ich bin so an Stücke gewöhnt, die mir vor vielen Jahren in diesen Gesamtausgaben begegneten – das Ave Maria von Cornysh ist ein Beispiel – ohne jegliche musica ficta, dass mir die Musik fast nichts bedeutet, wenn ficta hinzugesetzt wird, gegen all die sonstigen Instinkte, die ich zur Zeit hege. Es mag ein rechter Witz sein, dass ich mich unter Umständen ganz gegen meinen Charakter authentisch verhalte, wenn ich in der Angelegenheit der musica ficta nur meine eigenen Neigungen berücksichtige: es besteht guter Grund für die Annahme, dass die ursprünglichen Kopisten es genauso hielten. Das Problem besteht darin, dass es so viele Möglichkeiten gibt, und so wenig sichere Richtlinien – und die änderten sich sowieso im Verlauf des 16. Jahrhunderts.
Übersetzt aus dem Englischen von Irene Auerbach, vereinigtes Königreich
[1] Musica ficta ist im Englischen ein gängiger Fachausdruck für Vorzeichen, die in modernen Ausgaben alter Musik vom Herausgeber eingesetzt werden, aber nicht im Originalmanuskript stehen. Meist handelt es sich um die Erhöhung eines Tones um einen Halbton, meist den Leiteton in Kadenzen, die moderne Herausgeber und Sänger als notwendig empfinden, und von denen sie annehmen, dass die Sänger der Zeit, als die Komposition entstand, sie selbstständig sangen, weil sie so mit dem Stil vertraut waren, dass sie das geschriebene Vorzeichen nicht brauchten. Ganz gelegentlich wird auch ein Ton um einen Halbton erniedrigt, meist, um eine ungelenk erscheinende Melodieführung (gewöhnlich ein Tritonus) auszubügeln. Es liegt in der Natur des Problems, dass diese extra Vorzeichen ein unerschöpfliches Thema für gelehrte Diskussionen unter Herausgebern und Musikwissenschaftlern bieten, und es wird nie eine richtige oder eine falsche Lösung geben. In dieser Übersetzung wird musica ficta benutzt, wo der Verfasser nur ficta schrieb, wie es im englischen Musikalltag üblich ist. Anm. der Übersetzerin.