von Robert Lopez-Hanshaw
Warum sollte irgendjemand von einem Chor erwarten, in Mikrotonschritten zu singen? In der ganzen Literatur scheint es um ihre Begrenzung zu gehen.1 Jeder weiß, dass Chöre sowieso schrecklich konservativ sind. Sie und ihr Publikum würden ganz sicher beim leisesten Anzeichen von Fremdartigkeit aufbegehren. Einige preisen zwar ein solches Modell2 und sagen, dass die Grenzen der Chormusik in einer Menge menschlicher Stimmen angesichts der Moderne auf einen mehr traditionellen Stil eingeschränkt sind, und dass es gut so ist!
Das schließt offensichtlich mikrotonale Musik jeder Art aus. Das ist ziemlich seltsames Zeug.
Natürlich gibt es Risse in dieser Theorie. Wenn man auf Modelle abseits der westlichen Chormusik schaut, überwiegen in der Welt Beispiele beeindruckender Stimmkontrolle. Es gibt indische, türkische und arabische Sänger, für die ein wesentlicher Anteil der Musik aus sehr kleinen Intervallen besteht, ohne die die Identität einer gegebenen Melodie beeinträchtigt wäre. Besonders die ägyptische Sängerin Umm Kulthum war nicht nur eine fähige Interpretin dieser mikrotonalen Abstufungen in der Intervall-Qualität: sie war die Autorität richtiger Intonation.3
Selbst innerhalb der westlichen Musikszene gibt es die Idee der reinen Stimmung: die streng arithmetische, reine Stimmung, die sich von unserer modernen, logarithmischen Akkordstimmung in 12 gleichweiten Tonschritten unterscheidet. Diese hat sich langsam in das allgemeine Chorverständnis der letzten ein oder zwei Jahrhunderte eingebürgert, während der Ablösungsprozess ziemlich spät stattfand, nach der Renaissance.
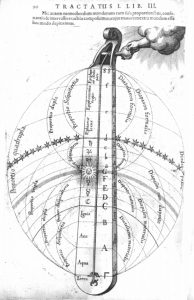
Aber die Beschränkungen der menschlichen Stimme sind etwas, womit man sich abfinden muss, was jene bezeugen können, die professionell aufgenommen wurden. Diese Grenzen werden beschämend durch eine Tonhöhenanalysen-Software wie Melodyne angezeigt, wenn man den Blick auf etwas wirft, wovon man meinte, es wäre eine ziemlich anständige Aufnahme gewesen. War ich wirklich so viele Cent daneben?
Komponisten*innen mögen seufzen und ihren Kopf schütteln, wenn sie denken: „Sicher, mikrotonales Singen ist möglich. Aber wenn ich nicht gerade von Exaudi oder den Neuen Vokalsolisten Stuttgart oder dem Roomful of Teeth einen Kompositionsauftrag bekomme, wird es nicht so stattfinden, wie ich es fordere!“
Achtung: es kann. Ich bin ein Chorkomponist und Dirigent, und ich bin auch ein Mikrotöner. In der letzten Zeit hatte ich einige Erfolge mit der mikrotonalen Ausbildung bei Chören, die im nächsten Artikel das Hauptaugenmerk sein wird. Danach wird mein Stück vokas animo, eine Komposition für Chor und Orchester in 72 Tönen pro Oktave, als Auszug einer Aufführung bei You Tube und bei NewMusicBox verfügbar sein.
Wie könnte sich so etwas ereignen? Mein Fall kann besonders unwahrscheinlich sein. Bis vor ziemlich kurzer Zeit hatte ich keinen Zugriff zu Gruppen, wie ich sie oben aufgeführt habe – kleine professionelle Vokalensembles, die regelmäßig mit extrem engen Intervallen spielen. Ich wuchs in Tucson, Arizona auf – und habe es nie verlassen. Tucson ist eine Chorstadt, die vom hervorragenden und international anerkannten höheren Studiengang für Chordirigieren an der University of Arizona lebt – nicht gerade ein Mekka der Neuen Musik.
Daher handelt dieser erste Artikel davon, wie ich die Mikrotonalität fand, oder wie sie mich durch Zusammenstöße mit Autoren und Kulturaspekten fand, die im Großen Ganzen nicht sehr mit Neuer Musik verbunden sind. Es geht darum, wie das mikrotonale Denken die von mir gemachte Musik beeinflusste und wie dieser Vorgang mich auf den Weg führte, den ich jetzt Chören vermittele. Normalen Sänger*innen.
Denn: wenn ich es lernen konnte, weshalb sie nicht?
Anfänge: Tonalität verwerfen
Ich kam später zur Musik als die meisten meiner Kollegen*innen. Vor dem Alter von elf Jahren hörte ich sie selten. Aber mit vierzehn hatte ich mit der Gitarre begonnen und lernte einige Rock- und Flamencomelodien aus gedruckten Gitarregriffen. Mit sechzehn lernte ich richtig Noten zu lesen und arbeitete mich dann durch eine antiquarische Harmonielehre, während mein Freund Unterricht in Musiktheorie nahm. Daher erinnere ich mich an mein Ringen mit den Grundlagen genau, und an die Erfolge ebenfalls. Ich schmecke immer noch die Köstlichkeit, wie ich übermäßige Sexten fand – wie verbotene Früchte! Ich erinnere mich an mein Körpergefühl, als mein Chorleiter etwa in der 7. Klasse zum ersten Mal auf dem Klavier einen Durakkord im Unterschied zu einem Mollakkord zeigte. Der Unterschied war so stark und gleichzeitig so fein! Ich verstand nicht, was sich da veränderte.
Es war elektrisierend, herauszufinden, wie diese Dinge zusammengefügt wurden. Auf diesem Hintergrund – Musik noch in ihrer Flitterphase, noch leuchtend und neu – kam meine erste Einführung zu Mikrotönen.
Als ich ungefähr 16 oder 17 war, lenkte ein Weblink auf einer vergessenen Website mich zu www.anti-theory.com, ein von Q. Reed Ghazala geschriebenes Programm, zu etwas, was er Circuit-Bending nannte. Er beschrieb, wie er sorgfältig, halb zufällig die Innereien von elektronischen Spielzeugen veränderte, so dass sie neue und starke Geräusche hervorbrachten. Ich landete auf einer Seite, die ein “Deep Photon Bassoon“ (tiefes Photonen-Fagott) beschrieb, über das hinweg ein Musiker mit der Hand wedeln konnte und Theremin-ähnliche Glissandi erzeugte. Ebenso konnte der Spieler mit der anderen Hand etwas tun, was mir verrückt vorkam: die Tonhöhen zu veranlassen, sich in Schritte aufzulösen – aber in „frei wählbare Skalenteilungen (so viele Schritte auch in einer Oktave vorkommen könnten)“.
Das war die coolste neue Sache, von der ich je gehört hatte.

Es gab noch kein YouTube. Daher, außer den gelegentlich furchterregenden Sound Clips auf Ghazalas Website, fand ich nur ein weiteres Beispiel während meiner damaligen Lebensperiode. Das war das Gitarrensolo in “When The Music’s Over“ von The Doors (die Stelle beginnt etwa nach 2:50 des betreffenden Tracks auf dem Album Strange Days).
Es klang absolut losgelöst von allem ringsherum, es klang, als ob der Gitarrist ohne Verwendung der Bundpositionen frei glitt. Ich dachte: „Das ist es, so klingen willkürliche Skalenteilungen!“
Fünfzehn Jahre später finde ich heraus, dass er kein Glissando verwendete. Und es sind keine „willkürlichen Skalenteilungen“ – es kommen nur viele mikrotonale Biegungen vor. Dennoch hatten die stark chromatischen und halb aleatorischen Nicht-Melodien, die ametrischen Rhythmen und das fremdartige Timbre sich vereinigt, einen Abschnitt zu erzeugen, der sich emphatisch von der ihn umgebenden Musik scheidet.
Zurückkommend auf den besonderen Fall mikrotonaler Chormusik: wir können den Gebrauch von Mikrotönen in diesem Solo – und die resultierende mehrstimmige Textur – mit dem ersten Satz der Tre Canti Sacri (1958) von Giacinto Scelsi vergleichen, besonders in der ersten Minute der Aufführung. Die Neuen Vocalsolisten Stuttgart haben es aufgenommen und haben ihre Aufführung auf YouTube bereitgestellt.4
In diesem Stück sind Gesten König und machen die Melodie überflüssig; Intervalle werden wohl wegen ihres Timbres verwendet, die in Dissonanzen vom puren Unisono und Quinten bis hin zu schnell pulsierenden Vierteltönen reichen. Die Atmosphäre ist spannungsgeladen und fremdartig – eine bevorzugte Stimmung in Kunstmusik des 20. Jahrhunderts. Und obwohl Scelsis Komposition im Gegensatz zu den frei zirkulierenden Soli von Robby Krieger eng fokussiert ist, wurde Mikrotonalität als Werkzeug in beiden Stücken verwendet: die tonale Hierarchie zu verlassen, um den Hörer für einen Augenblick von diesen Assoziationen zu befreien.
So etwas könnte einen Chorleiter nervös machen.
Letzten Endes sind tonale Hierarchien die Hälfte dessen, was Sänger verwenden, um Tonhöhen zu erzeugen, da es an unseren Kehlen keine Tasten gibt. Aber man muss sich nicht als Versager fühlen. Erstens gibt es nachvollziehbare Wege, eine Komposition wie diese anzugehen, indem man das verwendet, was in der Musik als Hilfsstruktur angelegt ist. Und zweitens: Musik, die Mikrotonalität explizit zur Vermeidung von vertrauten Strukturen verwendet, braucht meistens keine genaue Intonation zum Erfolg.
Beim Stück von Scelsi, möchte ich sagen, würde großenteils eine Abweichung von 30 Cent in beiden Richtungen noch immer die nötige Information vermitteln – undenkbar in tonalem Zusammenhang. (Eine faszinierende Fallstudie dieser Art von mikrotonaler Instrumentalmusik bei Knipper und Kreutz, Exploring Microtonal Performance of “…Plainte…“ by Klaus Huber, 2013).


Selbst in dieser hervorragenden Aufnahme hören wir solche Unterschiede. Zum Beispiel: die Viertelton-Annäherung zwischen dem H#¼ im Tenor 1 und C im Alt 2 in Takt 17 (ungefähr bei 0’38 auf dem Video) ist praktisch ein Unisono, während dieselbe Annäherung in Takt 45 (1’39) zwischen dem E von Tenor 1 und dem D#3/4 des Tenor 2 viel weiter ist, etwa einen Halbton erreicht. Dennoch bin ich zuversichtlich, dass nur wenige die Neuen Vocalsolisten beschuldigen würden, dem Werk Scelsis Unrecht anzutun.
Die andere Seite der Münze: Erweitern der Tonalität
Kehren wir zu einer Zeit zurück, in der ich von Scelsi noch nichts gehört hatte. Ich fing erst an, ernsthaft Komposition zu studieren und stolperte zum Glück beim Haushüten für Freunde der Familie über ein Buch. Es war The Shaping Forces in Music. An Inquiry Into the Nature of Harmony, Melody, Counterpoint, Form von Ernst Toch. [dt. Die gestaltenden Kräfte der Musik; Wolke Verlagsges. mbH, Hofheim/Taunus] Im Jahr 1948 veröffentlicht [engl. heute noch bei Dover], ist das Buch ein fesselnder (und weithin unbeachteter) Versuch, zwischen der Anwendung von Tonalität und Atonalität Gemeinsamkeiten zu finden. Ein Absatz, nur wenige Seiten lang, stach heraus. In ihm plädierte Toch dafür, Mikrotonalität als vereinbar mit jedem musikalischen Ansatz zu sehen. Er diskutierte sogar darüber, dass dies eine ordentliche Lösung eines „Problems“ bieten würde, in das ausgerechnet Beethoven geraten war:

In den Worten von Toch: „Bei der Annäherung an [Takt 8] … wird der sachte rhythmische Fortgang im Bass drei Schläge lang aufgehalten, und es gibt keinen Bewegungsraum mehr für die absteigende Stimme. … Das Problem könnte durch den Gebrauch von Vierteltönen wie gezeigt gelöst werden.“ Hier ist eine seiner möglichen Lösungen (er veränderte zur Verdeutlichung die inneren Stimmen):
Und er empfahl, es zu singen, als praktische Möglichkeit zur Erfahrung. „Es wird empfohlen, die Vierteltonpassage im Bass zu singen, während man den Rest der Passage auf dem Klavier spielt. Man wird über die Einfachheit der Aufgabe erstaunt sein, während das Novum durch die greifbare Logik vereinfacht wird.“ Für mich war dies ein Zitat, das hängenblieb. Ich nahm Tochs Ratschlag, später, wenn ich unauffällige mikrotonale Basslinien und Vokalharmonien schrieb, wann immer eine besondere tonale Problemstelle eine mikrotonale Lösung zu erfordern schien.
Kurz nachdem ich mit Tochs Buch bekanntgeworden war, besuchte ich eine Chor-Konferenz und irgendjemand erwähnte reine Stimmung für Chöre – als Stimmübung für konventionelle Musik. Es hörte sich geheimnisvoll an und ich vergaß alle Cents-Berechnungen, so interessant sie auch waren.
Ich besuchte auch einen merkwürdigen Kurs zum Bau von Instrumenten aus Metallschrott nach der Vorlage des Buchs Musical Instrument Design von Bart Hopkin [Tucson: See Sharp Press, 1996] (ein hervorragendes Buch zu Außenseiter-Möglichkeiten). In diesem Buch wird zum Teil auch über reine Intonation diskutiert, und, was für mich besonders wichtig war, im Anhang gibt es eine Stimmtabelle. Sie vergleicht die temperierte Zwölftonstimmung mit verschiedenen anderen Systemen, sowohl die reine Stimmung wie auch verschiedene äquidistante Teilungen der Oktave. Auch die Sammlung der 43 Töne von Harry Partch ist eingeschlossen. Ich war über die Vielfalt von Intervallen erstaunt, die irgendwie einen harmonischen Sinn ergaben. (Seine Kompositionen hörte ich allerdings erst Jahre später).
Während dies alles in meinem Kopf herumging, fing ich an, in einer Rockband zu spielen, und wir nahmen ein Album auf. Ein besonderer Gitarren-Take wies ein unglaubliches Timbre auf, allerdings auch einen Fehler, weshalb er wiederholt werden musste. Aber ich konnte das Timbre nicht mehr reproduzieren! Nach längerem Frust und Herumprobieren fanden wir heraus, dass die Gitarre beim ersten Take leicht verstimmt gewesen war; also war die große Terz kleiner als normal. Als ich die Saite für den Overdub neu gestimmt hatte, war die Eigenheit gelöscht. Ich erinnerte mich an Hopkins Buch und versuchte, die betreffende Saite in einer perfekten Quinte neu zu stimmen; und siehe da, das Timbre hatte sich wieder eingestellt. Ein sonderbar resonanter und gestützter Klang für eine große Terz auf einer übersteuerten Gitarre. Ich dachte: „So, das also macht die reine Stimmung.“
Später wurden enge vokale Akkorde das Kennzeichen unserer Rockband, in Live-Aufführungen hatten wir aber Schwierigkeiten, gut intoniert zu singen. Daher suchte ich, mit dem Gitarren-Experiment im Hinterkopf, nach einer Art Referenz, die uns aus dieser Situation herausführen könnte. Die fand sich in Harmonic Experience von W.A. Mathieu [William Allaudin Mathieu, Harmonic Experience: Tonal Harmony from Its Natural Origins to Its Modern Expression. Rochester: Inner Traditions, 1997], einem Handbuch zum Verständnis reiner Stimmung in der Praxis (und angewandt auf Jazz-Harmonie). Letzten Endes verwendete die Band keine der Übungen – leider! – , aber das Buch zeigte mir, wie es nötig sein könnte, ausgehaltene Töne durch leichtes Verschieben um ‚Kommas‘ zu veranlassen, die darunterliegenden wechselnden Akkorde in eine reine Stimmung zu bringen. Wichtiger noch war es Mathieu allerdings, dass er im Buch das körperliche Gefühl reiner Stimmung diskutierte. Das ist der Weg, diese neuen/alten Intervalle zu lernen.
Und sie sind wirklich alt. Nicolà Vicentino schrieb Stücke, in denen sich Teile der Überlegungen von Mathieu und Toch verbergen – im Jahr 1555. Das avantgardistische Vokalensemble Exaudi hat richtungsweisende a-cappella-Aufnahmen von Vicentinos mikrotonalen Experimenten vorgelegt, die man bei YouTube anhören kann; die Krönung ist Dolce mio ben.5
Dies hat sowohl einen an reine Stimmung erinnernden Aspekt – enge große Terzen und sehr weite kleine Terzen – wie auch einen vierteltonartigen, der an Tochs Einfügung von Mikrotönen in eine im Übrigen chromatische Linie ähnelt. Inmitten einer – wie wir heute sagen würden – V-I-Fortschreitung auf G setzt Vicentino einen „extra“ Leitton zwischen Fis und G. Aber anders als Toch stimmt er einen ganzen Akkord auf diesen zwischengeschalteten Ton. Dies geschieht bei 0:18 in dem von mir herangezogenen YouTube-Video – siehe den Partiturauszug unten (der Text ist vereinfacht).

Es ist weder echte Vierteltönigkeit noch wirklich reine Intonation. Es ist tatsächlich in 31-töniger gleichdistanter Stimmung [31-TET], deren moderne Standardnotation ungefähr alle chromatischen und vierteltönigen Versetzungszeichen neu interpretiert; es sollte jedoch klar sein, was passiert. Übrigens liebt Vicentino diese Figur, und sie taucht jederzeit in seiner überlieferten mikrotonalen Musik auf.
So, lange bevor ich den Sprung wagte und beschloss, in Mikrotönen zu komponieren – und dabei mit der zahlreichen Literatur und dem Repertoire Fahrt aufnahm, die es draußen gibt – war ich mit zwei vollständig verschiedenen Philosophien über Mikrotonalität konfrontiert worden. Entweder entkomme ich Dem System, oder ich helfe ihm, irgendwie es selbst zu werden. Und oberflächlich haben sich diese Kategorien recht gut erhalten, was die Hilfe zur Ausführung einer bestimmten Passage betrifft.
Eine Sache hätte ich jedoch gerne schon als Jugendlicher lesen wollen, nämlich eine Art von zusammengefasstem Überblick über alle Wege, wie man Mikrotonalität in westlicher Musik verwendete. Bis vor kurzem schien nichts dieser Art vorhanden zu sein – alles hatte sein eigenes enges Programm und war sowieso für mein Teenager-Verständnis zu technisch. Wie wir gesehen haben, blieb es mir überlassen, nach und nach ein unvollständiges Bild von hier und dort aufzulesen. Im letzten Jahr aber veröffentlichte Kyle Gann The Arithmetic of Listening [The Arithmetic of Listening: Tuning Theory and History for the Impractical Musician (Champaign: University of Illinois Press, 2019)], und jetzt braucht keiner von uns mehr dieses Los zu erleiden.
Dieses Buch ist wahrscheinlich die wichtigste zeitgenössische mikrotonale Nachschlagemöglichkeit, weil es einen Überblick über viele der bisher genutzten Wege der Mikrotonalität gibt; aber es ist gleichzeitig ein Muster dafür, wie man sie lehren kann. Stimmkonzepte wie die Pythagoräische Stimmung, Mitteltönigkeit, Zwölftönigkeit in gleichweiten Schritten und Barbershop-Intonation werden durch die Linse sich immer weiter entwickelnder erster Grenzen des harmonischen Vokabulars erläutert. Nachdem die 13er-Grenze überschritten ist (mit Diskussionen von Ben Johnston, Toby Twining und Ganns eigener Hyperchromatica), widmet sich der Text den Oktaven in äquidistanten Schritten und belegt nicht nur, was sie sind, sondern was sie tun. Er enthält die einzige hilfreiche Hinführung zur Theorie der normalen Stimmung, der ich begegnet bin, und wird eine Rettungsinsel für jeden sein, der versucht hat, in den trüben Wassern des Internets zu diesem Thema zu schwimmen.
Dennoch gibt es dort einige Dinge, mit denen ich nicht einverstanden bin: die Minianalyse des 5. Streichquartetts von Ezra Sims wird nur mit EDO-Schritten [equal division of the octave –gleichstufige Oktaventeilung anders als 12 Tonschritte] erklärt, obwohl Sims häufiger in dem Sinne zitiert wird, dass sein Gebrauch einer 72stufigen Oktavteilung als harmonisch (d.h. ratiogegründet) angesehen wird. Und der kurze Absatz über nicht-westliche Stimmsysteme ist mit so viel Ablehnung versalzen (wie z.B. „muss nicht als ziemlich repräsentativ dafür angesehen werden, wie diese Kulturen ihre eigene Musik verstehen“), dass es auch ein wenig salzig herüberkommt. Und sollte jemand nach strikt atonalen Ressourcen in diesem Buch suchen, wird er/sie es unzufrieden verlassen – das Buch diskutiert nicht viele organisierte Wege, wie man mikrotonale Strukturen ohne den Bezug auf eine globale oder lokale Stimmung verwendet (also 1/1). Dennoch ist Arithmetic of Listening das erste Buch, das ich jedem empfehlen würde, der eine ernstzunehmende Einführung in die Mikrotonalität sucht. Ich wünschte, es hätte früher das Licht der Welt erblickt.
Die Leichtigkeit der Aufgabe
Aber zurück zur vorliegenden Beschreibung: die Art und Weise, mit der ich zuerst mikrotonale Methoden kennenlernte, sind für Anfänger leicht zu begreifen, und ich betrachte das als einen fantastischen Glücksfall.
Warum kann man zwischen Tönen singen? Weil sie dazwischen sind. Man startet irgendwo und kommt irgendwo an, beide Stellen sind fest und bekannt. Als ich auf einem vokalen Hintergrund für einen Country-Song einen „doppelten Leitton“ nach der Art von Ernst Toch aufnahm, war es im Zusammenhang völlig natürlich, nur eine leichte Erweiterung einer Stimmführung, die in Pop-Stilen vorkommt. Es brauchte keine besondere Übung, das aufzunehmen. Jeder kann das machen: und ich habe Leuten beigebracht, es zu tun.
Warum kann man in Intervallen singen? Weil sie, wie Mathieu sagt, ebenso gefühlt wie gehört werden. Obwohl reine Intonation ein theoretisches Konstrukt wie alles andere ist, bleibt doch wahr, dass sie leicht wahrzunehmende Referenzpunkte liefert, die man treffen kann. Wenn man gut eingestimmt singt, rastet es ein – wie bei einem Barbershop-Ensemble. Die wissen, wie man einen perfekten 7/4-Ton trifft, nicht wegen des Verstandes, oder weil es 31 Cents niedriger als eine gleichschwebend kleine Septime ist oder was auch immer. Viele von diesen Typen können noch nicht einmal Noten lesen. Sie wissen es, weil der Akkord schwingt, in einer Art, die sich von den Ergebnissen anderer naheliegender Stimmungen abhebt. Weshalb kann also der Rest von uns solch neue Konsonanzen nicht erlernen? Einige von ihnen sind ein bisschen anspruchsvoller als 7/4, einige von ihnen aber nicht so sehr mehr. Ich komme noch einmal darauf zurück: ich hatte einigen Erfolg, das Menschen beizubringen, die beim besten Willen keine Avantgarde sind.
Abseits dieser Anwendungen (die, nebenbei gesagt, schon Pop-Musik über solche Gruppen wie Jacob Collier6 und They Might Be Giants7 infiltrieren), sollten wir uns in Erinnerung rufen, dass es auf der Welt eine große Auswahl zu lernender Intervalle gibt – viel mehr als die einfacheren Verhältnisse der Reinen Stimmung. In manchen Kulturen werden Intervalle angewendet, die sich an keinerlei harmonischer „Landmarke“ ausrichten. Daher muss ein Stimm-Standard klar nicht von akustischen Erscheinungen abhängen.
Es ist schwieriger, solche unharmonischen Intervalle zu lernen – entweder als Teil eines traditionellen, mir unbekannten Systems, oder aber ein neues – aber mit Hilfe ist es möglich. Ich habe Leuten auch beigebracht, das zu tun. Es hilft dem Durchhaltewillen auch, daran zu erinnern, dass alle unsere bekannten 12tönigen Intervalle tatsächlich ebenfalls unharmonisch sind (mit Ausnahme der Oktave). Daher sind alle herkömmlichen, mit denen man großgeworden ist, tatsächlich ebenfalls unharmonisch wie diejenigen, die man zu lernen versucht!
Diese Dinge zu einem einheitlichen Konzept zu verschmelzen ist überraschend intuitiv. Sie können gut mit chorischen Standardverfahren verschmelzen, wenn man nur ein wenig erfinderisch bei der Verwendung von Techniken ist, bei der Rolle des Klaviers, der Stimme des Chorleiters. Vieles davon kann mit denselben Grundtricks erreicht werden, die man zum Erlernen von diatonischen und chromatischen Intervallen bei Kindern anwendet. Indem ich dies alles anwendete, unterstützt von den Strategien von Fahad Siadat, Ross Duffin, Robert Reinhart und anderen, fand ich einen ganzen Werkzeugkoffer, um einem Chor fast jedes mikrotonale Stück beizubringen – letzten Endes.
Zum Beibringen jedes anspruchsvollen Stücks braucht man Zeit. Und es gibt manche mikrotonale Kompositionen, die viel angsteinflößender als andere sind; aber das trifft für alle Genres zu, mikrotonal oder nicht. Die Sache ist die, dass man diese Werkzeuge als Eingangspunkt zu jedem Stück verwenden kann, eher als auf etwas wie Ben Johnsons Sonnets of Desolation zu schauen und, na ja, in Verzweiflung zu versinken.
Ich hoffe, dass mehr Chorleiter dies sehen könnten und dazu inspiriert sind, mit ihren Ensembles mehr Zeit auf das Erlernen solches mikrotonalen Repertoires zu verwenden. Die Belohnungen können groß sein: nicht nur von einem künstlerischen Standpunkt aus, sondern auch für den Weg, den das Verständnis für Mikrotonalität in Bezug auf die Intonationsfähigkeiten für ein Standardrepertoire ebnet.
Nächstes Mal mehr in einer Diskussion über aktuelle Probetechniken!
[1] https://nmbx.newmusicusa.org/writing-for-the-chorus-text-dynamics-and-other-occupational-hazards/
2 https://www.cpr.org/2014/03/11/is-modern-music-inaccessible-not-for-choral-music-fans/
3 [Johnny] Farraj and [Sami Abu] Shumays, Inside Arabic Music [ – Arabic Maqam Performance and Theory in the 20th Century, Oxford University Press] 2019
4
5 https://www.youtube.com/watch?v=4vM3p4rtdbs
6 https://www.youtube.com/watch?v=NHC2XNGerW4
7 https://www.youtube.com/watch?v=sxbporF6GCw

Robert Lopez-Hanshaw ist Musikdirektor beim Tempel Emanu-El in Tucson, Arizona, und Gast-Komponist-in-Residenz beim Southern Arizona Symphony Orchestra. Er ist auch der Herausgeber von ”Practical Microtones”, ein Handbuch für Fingersätze und Spielpraktiken in 72-TET für alle Standard-Orchesterinstrumente, zur Veröffentlichung Anfang 2021. Lopez-Hanshaw ist Fachmann für die Mikroton-Pädagogik und für aschkenasisch-jüdische Gesangsweisen, z.B. bei solchen Ereignissen wie dem Nordamerikanischen Jüdischen Chorfestival, dem mikrotonalen Musikfestival BEYOND, den Musikern des Guild of Temple, und der zweijährlichen Konferenz der Nordamerikanischen Saxophonvereinigung. Seine Kompositionen wurden von der Gemeinschaft und religiösen Organisationen in Süd-Arizona gesponsert, ebenso von einzelnen Interpreten in den ganzen Vereinigten Staaten. Sein Stück “vokas animo” für Chor und volles Orchester in 72-TET wurde im Januar 2020 vom Tucson Symphony Orchestra and Chorus uraufgeführt. eMail: robert.a.hanshaw@gmail.com
Übersetzt aus dem amerikanischen Englisch von Klaus L Neumann, Deutschland


I like this article very much!